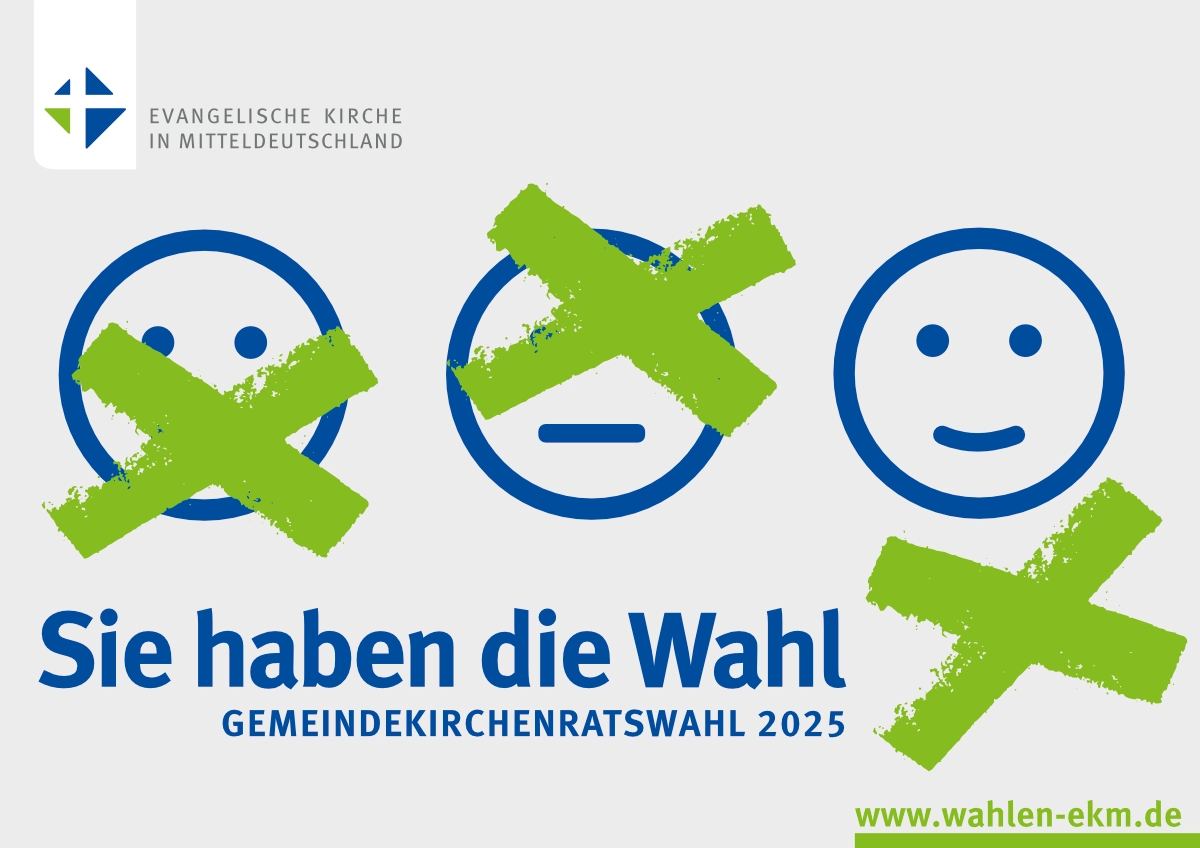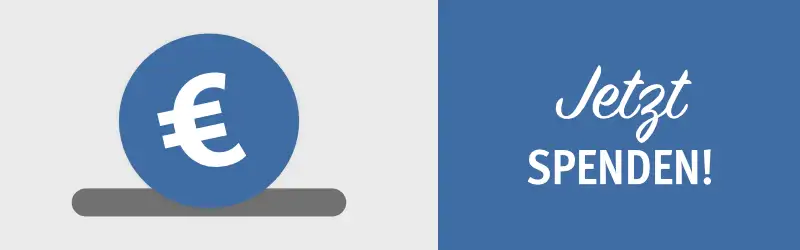27.07.2021
Ein „Edelstein“ in Harbke: die Fritzsche-Treutmann-Orgel von 1622/1728
Die Geschichte einer Orgel ist zumeist eng mit jener ihrer Wirkungs- oder auch Klangentfaltungsstätte verknüpft. So verhält es sich auch mit der Fritzsche-Treutmann-Orgel in der St.-Levin-Kirche von Harbke im Pfarrbereich Hötensleben (Kirchenkreis Egeln).
Als Achaz II. von Veltheim 1572 die „Obere Schloss- und Pfarrkirche St. Levin“ auf den Grundmauern eines älteren Gebäudes erbauen ließ, konnte er noch nicht ahnen, welcher „Edelstein“ unter den Orgeln seine Kirche einmal schmücken würde. Denn erst zwei Generationen später (1621/22) errichte Gottfried Fritzsche, seinerzeit einer der bekanntesten Orgelbauer in Mittel- und Norddeutschland, im Auftrag derer von Veltheim eine 18 Register umfassende Orgel, die über dem Altar und der Kanzel stand.
In den Jahren 1719/20 wurde das Gotteshaus um einen quadratischen Westturm erweitert und erhielt auch eine dreiseitige Empore. Diese bauliche Veränderung ermöglichte es 1727/28, die Orgel durch Christoph Treutmann dem Älteren zu erweitern. Bei seiner Überarbeitung behielt Treutmann große Teile des ursprünglichen Pfeifenwerks bei. Diese Pfeifensätze sind heute das einzig verbliebende Erbe aus der Orgelbau-Werkstatt von Gottfried Fritzsche, zu dessen Lebenswerk auch die Orgeln in der Dresdner Schlosskapelle und Bayreuth Stadtkirche gehörten. Doch beide Instrumente sind nicht mehr erhalten.
Seit der Erweiterung von 1727/28 verfügt die Orgel von St. Levin in Harbke über ein Rückpositiv, umfasst insgesamt 22 Register und befindet sich auf der Empore. Das neu gebaute Rückpositiv in der Emporenbrüstung ist überdurchschnittlich weit von der Hauptorgel entfernt, was von Organisten als musikalisch reizvoll beschrieben wird, da der Klangeindruck für den Zuhörer direkter ist: Die Töne der Solopfeifen des Rückpositivs werden klarer in das Kirchenschiff getragen, während das „tutti“ der Hauptorgel im Hintergrund wirkt.
Andere Teile, insbesondere des Gehäuses, sind von den Mitarbeitern Treutmanns ganz pragmatisch „recycelt“ worden: Die ehemalige Registrierstaffel stützt nun die Pedalwindlade - die originalen Registrierbeschriftungen sind noch zu sehen. Die alten bemalten Spieltischtüren wurden als Abdeckung des Hauptwerkgebäudes zweckentfremdet.
Dass die Pfeifen erhalten blieben, ist heute ein großes Glück, war aber dem schmalen Budget der Auftraggeber und nicht einer sentimentalen Geste oder gar denkmalpflegerischen Interessen geschuldet. Christoph Treutmann der Ältere, der als einer der berühmtesten Orgelbaumeister der Barockzeit gilt, wurde in Harbke zur Sparsamkeit angehalten. Treutmann werden unter anderem die Orgel im Braunschweiger Dom, aber auch in kleinen Städten wie Egeln, Diesdorf und Calvörde zugeschrieben. Historische Dokumente belegen, dass er auch das ursprüngliche Klangbild des Instruments in Harbke übernehmen musste, das damals als "altmodisch" galt. Es wird als modifizierte mitteltönige Stimmung beschrieben. Seine Klangfülle begünstigt den praktischen Einsatz der Orgel im Gottesdienst.
Im Verlauf der Jahrhunderte erfuhr die Orgel außer Erhaltungsmaßnahmen nur wenige Veränderungen, so dass sie fast zur Gänze, auch das Orgelprospekt mit den geschnitzten Akanthusranken, aus originalen Teilen besteht.
Bis 1945 trat die Familie von Veltheim als Mäzen und Förderer auf. St. Levin diente ihnen auch als Grablege - davon künden zahlreiche Epitaphe und Grabsteine. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs und der anschließenden Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone ging ihre fast 640 Jahre andauernde Familiengeschichte in Harbke zu Ende.
Als die Führung der DDR im Mai 1952 ihr Land mit einem 5 Kilometer breiten Sperrgebiet entlang der Grenze zur Bundesrepublik Deutschland abriegelte, schnitt sie auch Harbke „vom Rest der Welt“ ab. Das Harbker Schloss diente als Waisenhaus und stand später leer. Die Wirtschaftsgebäude wurden von der LPG genutzt.
Die Kirche wurde weiterhin für Gottesdienste genutzt. Fachleute wiesen auch zu DDR-Zeiten auf die Einmaligkeit dieses Kleinodes hin, doch für Sanierungs-, Restaurierungs- oder Instandhaltungsarbeiten fehlten der Kirchengemeinde das Geld. Dies führte zu einer kaum noch bespielbaren Orgel.
Erst mit der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 erhielt die Kirche öffentliche und sogar internationale Aufmerksamkeit: Orgelbauer aus Holland, Japan und Dänemark gaben Empfehlungen für eine Restaurierung nach historischem Vorbild.
Doch zuvor musste die vom Schwamm befallene Kirche baulich instand gesetzt werden. In mehreren Bauabschnitten wurden ab 2003 der Dachstuhl und die Decke des Kirchenschiffs, die Wände, die Renaissance-Ausstattung mit der bemalten Empore und die stuckbesetzte Holzbalkendecke restauriert.
Im Mai 2007 begannen die Arbeiten an der Orgel in den einzelnen Werkstätten der Christian Wegscheider aus DresdenOrgelbauer Jörg Dutschke aus Salzwedel.
Schon im November fanden die ersten Klangproben statt. Die Abnahme der Orgel erfolgte am 6. Dezember 2007. An Christi Himmelfahrt 2008 wurde die „Königin von Harbke“ in einem Festgottesdienst durch den damaligen Bischof Axel Noack wieder eingeweiht.
Seitdem wird die Orgel viel bespielt: von angehenden Kirchenmusikern und Organisten aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Durch ihre originale Disposition (den Klang) ist sie besonders für die Aufführung von Orgelmusik aus dem 17. und 18. Jahrhundert zu empfehlen.
Besuchen sie ein Konzert des Harbker Orgelsommers! Die Termine finden Sie auf der Homepage des Kirchenkreises Egeln. Oder wandern Sie gern auf Goethes Spuren? Denn der Dichter verweilte im August 1805 einige Tage auf Schloss Harbke und ruhte unter dem über 200 Jahre alten Gingko-Baum im Schlosspark. Ob er auch in der Kirche war und jemandes Orgelspiel lauschte? Vielleicht hatte er das Vergnügen.
Mehrere Förderer taten sich für die Restaurierung der Orgel zusammen: Land Sachsen-Anhalt (84 600 Euro), ZEIT-Stiftung (75 000 Euro), Reemtsma-Stiftung (40 000 Euro), Lotto-Toto Sachsen-Anhalt (27 000 Euro), Deutsche Stiftung Denkmalschutz (5000 Euro), Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen (52 000 Euro), Kirchenkreis Egeln (15 000 Euro), Oetker-Stiftung (13 000 Euro), Kirchengemeinde Sankt Levin Harbke (8400 Euro)
Gesegnet seien die Geber!